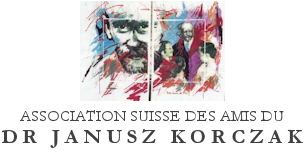1905
Nach Abschluss des Medizinstudiums wird Korczak in die russische Armee einberufen und im Krieg gegen Japan in den Fernen Osten gesandt. Er befasst sich mit der Evakuierung von Kranken aus Charbin nach Chabarovsk und interessiert sich für die Situation der Zivilbevölkerung und das japanische Schulsystem. Seine Berichte erschienen in der Zeitschrift «Glos» (Die Stimme) bis zu ihrem Verbot durch die russische Zensur Ende 1905.
Eine Sammlung von Artikeln aus der Zeitschrift wird unter dem Titel «Koszalki-Opalki» (Belanglosigkeiten) veröffentlicht.
1906 – 1908
Nach der Rückkehr nach Warschau schreibt Korczak für die Zeitschrift Krytyka Lekarska (Medizin-Kritik) – unter dem Pseudonym Henryk Goldszmit – und setzt seine literarische und pädagogische Arbeit fort. Die Veröffentlichung seines Romans «Das Salonkind» macht ihn berühmt und er wird zum gefragten Arzt und ist «in».
Er reflektiert sowohl die Schule wie auch die Rolle des Erziehers.
Der Feuilletonroman «Feralny Tydzien» (Eine unglückliche Woche), der eine Kritik der traditionellen Schule enthält, und der Artikel «Szkola Zycia» (Die Schule des Lebens), welcher für die Zeitschrift «Przeglad Spoleczny» (Sozial-Revue) die Prinzipien einer Schule im Dienste der «Ziele der gesamten Menschheit und nicht nur der Interessen einer Klasse» beschreibt, erscheinen.
Die Tätigkeit als Erzieher in einer Ferienkolonie für jüdische Kinder im Dorf Michalowka ermöglicht Korczak neue Beobachtungen und Erfahrungen und gibt Anlass zum Buch «Die Mojscheks, Joscheks und Sruleks» (Jüdische Vornamen).
1908 schreibt Korcazk nach einem weiteren Aufenthalt in einer Ferienkolonie für katholische Kinder in Wilhelmowka «Die Jozeks, Jasieks und Franeks» (Polnische Vornamen). Die beiden Werke, die zunächst in der Form von Artikeln erscheinen, werden später vervollständigt und schliesslich in Buchform veröffentlicht (1910 und 1911).
1909
Korczak wird verhaftet und verbringt kurze Zeit in derselben Zelle wie Ludwik Krzywicki, ein hervorragender sozialistischer Soziologe Polens.
Er nimmt mit der Gesellschaft, welche sich der Hilfe für jüdische Waisenkinder in Warschau widmet, Kontakt auf und wird Mitglied der Direktion und einer der Vorkämpfer für den Bau eines modellhaften Waisenhauses.
1911
Am 26. Mai wird der Bauplan für das Waisenhaus genehmigt; er folgt modernen pädagogischen und sozialen Prinzipien, und Korczak achtet darauf, dass die individuellen Bedürfnisse der Kinder erfüllt und direkte Verbindungen zwischen Innen- und Aussenwelt des Waisenhauses (Kontakte mit Kindern sowie mit den Familien früherer Kameraden und Mitschülerinnen) ermöglicht werden.
Vermutlich im gleichen Jahr besucht Korczak pädagogische Einrichtungen und ein Waisenhaus in London; in der Folge beschliesst er, kein eigenes Heim zu gründen: «Ein Sklave hat kein Recht Kinder zu haben. Ich, also polnischer Jude unter zaristischer Besatzung… ich habe die Idee des Dienstes am Kind und seiner Sache gewählt…» (Brief an M. Zybertal vom 30. März 1937).
1912
Korczak verlässt das Spital, wo er während sieben Jahren gearbeitet hat, und wird Direktor des
Hauses des Waisenkindes.
Am 7. Oktober richten sich Korczak und Stefania Wilczynska als Leiter und Leiterin zusammen mit den Waisenkindern im neuen Haus an der Krochmalnastrasse 92 ein. Korczak und Wilczynska erhalten für ihre Arbeit keinen Lohn, und von diesem Zeitpunkt an bleibt ihr Leben ans Schicksal des Waisenhauses gebunden – im Guten wie im Schwierigen – bis zum Ende.
1913
Am 27. Februar wird das Waisenhaus feierlich eingeweiht. Korczak gestaltet das Zusammenleben im Heim Schritt für Schritt zu einer Kindergesellschaft, welche nach den Prinzipien der Gerechtigkeit, Brüderlichkeit und Gleichheit in Rechten und Pflichten aufgebaut ist. Er schafft ein Erziehungssystem, wo jedes Kind zugleich «Hausmeister, Mitarbeiter und mitverantwortlich» ist («Jak kochac dziecko» auf Deutsch erschienen unter dem Titel
Wie man ein Kind lieben soll (spätere Übersetzung: Ein Kind lieben)).
Veröffentlichung des Kinderbuches «Slawa» (Der Ruhm).
1914
Veröffentlichung eines weiteren Buches mit den drei Beiträgen «Bobo», «Feralny Tydzien», «Spowiedz Motyla» (Bobo, Eine Unglückswoche, Beichte eines Schmetterlings). Nach Ausbruch des ersten Weltkriegs wird Korczak als Oberarzt des Divisionsspitals an die Front einberufen. Stefania Wilczynska kümmert sich allein um die Leitung des Waisenhauses und führt trotz grossen materiellen Schwierigkeiten das pädagogische Werk Korczaks fort.
1915 – 1917
Korczak arbeitet in der Nähe von Kiew in der Ukraine in Kinderheimen und sammelt Beobachtungen bei Kindern im Vorschul- und Schuleintrittsalter.
1915 nimmt Korczak während eines Kurzurlaubs am Leben eines Knabeninternats in Kiew teil, welches von Maryna Falska geleitet wird, mit der er später in Polen zusammenarbeiten wird.
1918
Das Jahr der polnischen Unabhängigkeit: Nach der Rückkehr aus dem Krieg nimmt Korczak seine pädagogischen und literarischen Aktivitäten wieder auf. Von der Front hat er das Manuskript seines pädagogischen Grundlagenwerks «Jak kochac dziecko» (Wie man ein Kind lieben soll (spätere Übersetzung: Ein Kind lieben)) mitgebracht, das er «im Kanonendonner» geschrieben hat.