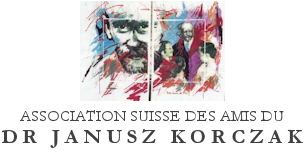Am 1. September – Ausbruch des Krieges. Korczak fasst den Beschluss mit den Kindern im gemeinsamen Haus zu bleiben.
Korczak übernimmt den Wachdienst und steigt auf das Dach des Waisenhauses, um Brandbomben zu löschen.
Korczak ist im Radio aktiv und ruft zur Ruhe und Hilfe bei der Organisation eines Dienstes für hilfsbedürftige Personen auf. Er setzt seine ganze Kraft zur Sicherung des Betriebs des Waisenhauses ein.
Im Oktober befehlen die Nazis die Schaffung eines Ghettos für die jüdische Bevölkerung. Trotz verzweifelten Bemühungen Korczaks muss das Waisenhaus in die ehemalige Handelsschule an der Chlodnastrasse 33 umziehen, in ein Gebäude das für ein Heim mit hundertfünfzig Kindern ungeeignet ist. Dennoch wird der Schulunterricht organisiert, die Kinder richten eine Wandzeitung ein und arbeiten in verschiedenen Bereichen. Das Kameradschaftsgericht und das Kinderparlament funktionieren weiter.
Verhaftet durch die Deutschen und eingesperrt im Schreckensgefängnis von Pawiak (weil er auf der Herausgabe einer Lieferung Kartoffeln für die Kinder des Waisenhauses beharrt hat), kommt Korczak auf Kaution frei, welche von seinen Freunden bezahlt wird.
Korczak widmet ganze Tage dem Sammeln von Gaben, um das Überleben des Waisenhauses und seiner Bewohner zu sichern.
Krank und erschöpft übernimmt Korczak die Leitung eines weiteren Waisenhauses an der Dzielnastrasse 39, wo gegen sechshundert Kinder als Folge von Krankheiten und Mangelernährung vom Tod bedroht sind («ein Vorbegräbnishaus für Kinder», wie Korczak es bezeichnet). Es gelingt ihm die Atmosphäre zu verbessern, den Hunger zu mildern und die Hygiene ein wenig zu verbessern – im Kampf mit dem entmutigten Personal. Korczak wohnt nach wie vor im Waisenhaus an der Sliskastrasse. Vom Mai des Jahres 1942 an schreibt er nachts sein Tagebuch (welches nach dem Krieg veröffentlicht wird), ein bewegendes autobiografisches Dokument, ein ebenso nüchternes wie unbestechliches Zeugnis der Nazigräuel.
Am 8. Juni findet die Weihe der grünen Fahne des Waisenhauses statt (grün als Farbe der Hoffnung und der Natur). Die Kinder geloben, «die Liebe für die Menschcen, das Recht, die Wahrheit und die Arbeit zu hüten».
Am 18. Juli findet im Waisenhaus die Aufführung des von den Nazis verbotenen Theaterstücks Das Postamt von Rabindranath Tagore statt. Befragt über die Wahl dieses Stücks (es geht um ein krankes Kind, welches in seinem Zimmer liegt und stirbt, während es davon träumt, über Felder zu laufen,) antwortet Korczak, dass es wichtig sei zu lernen , den Tod mit Heiterkeit anzunehmen.
Am 22. Juli, Korczaks Geburtstag, beginnt die «Liquidierung» des Warschauer Ghettos. In den Strassen beginnen die Razzien. Dreimal wird Korczak gefasst und vom «Todeskarren» mitgenommen; jedes Mal wird er wieder ins Waisenhaus zurückgeschickt.
Am 4. August werden Korczak, Stefania Wilczynska, die Erziehrinnen und Erzieher und zweihundert Kinder zum «Umschlagplatz» geführt (von wo aus die Züge in die Vernichtungslager fahren). Sie werden in die bereit stehenden Viehwaggons eingesperrt und ins Vernichtungslager Treblinka gebracht.
Dieser chronologische Abriss folgt dem Kalendarium des Lebens, der Tätigkeiten und des Werks von Janusz Korczak, welches vom Institut für pädagogische Forschung des Ministeriums für Bildung und Erziehung, dem Institut zur Erforschung von Erziehungssystemen und der Forschungsstelle Janusz Korczak 1978 in Warschau herausgegeben worden ist; der Abriss findet sich auch in Korczaks Buch Wie man ein Kind lieben soll (spätere Übersetzung: Ein Kind lieben).